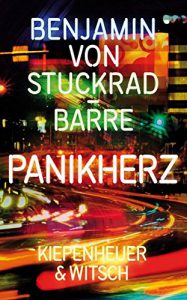 Benjamin von Stuckrad-Barre ist Schriftsteller, Journalist und Moderator. Seit seinem Debutwerk „Soloalbum“ (1998) gilt er als bedeutender, deutscher Popliterat. Nach verschiedenen Praktika folgten Anstellungen als Redakteur beim deutschen Rolling Stone, als Produktmanager beim Plattenlabel Motor Music und als Autor der Harald Schmidt Show. Nebenbei war er als freier Mitarbeiter diverser Zeitungen und Magazine wie FAZ, Die Woche, Stern und taz tätig. Nach turbulenten Anfangsjahren und verschiedenen Buch- und Artikelveröffentlichungen hat er sich seit 2010 wechselnden TV-Formaten gewidmet. Stuckrad-Barre moderierte u.a. „Stuckrad Late Night“ (ZDFneo), „Stuckrad-Barre“ (Tele 5) und „Stuckrads Homestory“ (RBB), allesamt mit eher mäßigem Erfolg. Mit dem autobiographisch geprägtem „Panikherz“ schließt er wieder an seine früheren literarischen Erfolge an und legt eine gewichtige und nüchterne (!) Selbstbetrachtung vor. Weiterlesen
Benjamin von Stuckrad-Barre ist Schriftsteller, Journalist und Moderator. Seit seinem Debutwerk „Soloalbum“ (1998) gilt er als bedeutender, deutscher Popliterat. Nach verschiedenen Praktika folgten Anstellungen als Redakteur beim deutschen Rolling Stone, als Produktmanager beim Plattenlabel Motor Music und als Autor der Harald Schmidt Show. Nebenbei war er als freier Mitarbeiter diverser Zeitungen und Magazine wie FAZ, Die Woche, Stern und taz tätig. Nach turbulenten Anfangsjahren und verschiedenen Buch- und Artikelveröffentlichungen hat er sich seit 2010 wechselnden TV-Formaten gewidmet. Stuckrad-Barre moderierte u.a. „Stuckrad Late Night“ (ZDFneo), „Stuckrad-Barre“ (Tele 5) und „Stuckrads Homestory“ (RBB), allesamt mit eher mäßigem Erfolg. Mit dem autobiographisch geprägtem „Panikherz“ schließt er wieder an seine früheren literarischen Erfolge an und legt eine gewichtige und nüchterne (!) Selbstbetrachtung vor. Weiterlesen
Musikproduktion: „Nights in White Satin“ von Sandra Buchner
In den letzten Monaten habe ich für die Würzburger Sängerin Sandra Buchner drei Einzeltracks produziert. Wir hatten bereits im Sommer mit der Auswahl passender Songs begonnen, im Herbst fiel dann die Entscheidung, danach haben wir losgelegt und im Verlauf der Produktion verschiedene Ansätze, Ideen und Sounds ausprobiert, auch für die Mixe haben wir uns viel Zeit genommen. Inzwischen ist alles fertig und abgeschlossen.
Sandra Buchner hat gerade einen ersten Track auf Soundcloud gestellt und in ihrem eigenen Blog präsentiert. Es handelt sich dabei um eine Neuinterpretation des alten Schmachtfetzens „Nights in White Satin“. Wir haben den Streicherkitsch entfernt, das Metrum verändert (von 6/8 nach 4/4) und eine loungige Elektroversion geschraubt. Mit dabei Fritz Wenzel an der Querflöte, vielen Dank!
Jetzt freuen wir uns auf interessierte Hörer. Kommentare und Feedback sind wie immer willkommen.
Video: „I’d rather go blind“ von Trixie Whitley
Like Father, like Daughter: Trixie Whitley ist die Tochter von Chris Whitley (1960-2005). Gerade wurde – nach 2 EPs und dem Debutalbum „Fourth Corner“ (2013) – ihr zweites Album „Porta Bohemica“ veröffentlicht. Der tanzende Derwisch im Video ist übrigens nicht Rick Rubin, sondern der Musikproduzent Daniel Lanois, der auch schon beim Debut des Vaters („Living with the Law“, 1991) mitgewirkt hat.
Buch: „Inside Chefs’ Fridges, Europe“ von Carrie Solomon & Adrian Moore
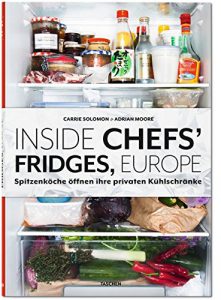 Carrie Solomon ist Foodfotografin, Adrian Moore schreibt Artikel über kulinarische Trends, beide leben und arbeiten in Paris. Jeder kennt den Ausspruch „die kochen auch nur mit Wasser“. Stimmt das, ist das wirklich so? Solomon und Moore haben sich gemeinsam gefragt mit welchen Zutaten kochen Europas Spitzenköche in ihren privaten Küchen daheim. Und was wäre da hilfreicher als ein Blick in deren Kühlschranke? Also haben sie sich aufgemacht, sind quer durch Europa gereist, haben insgesamt 40 Sterneköche besucht und den Inhalt ihrer privaten Kühlschränke inspiziert und dokumentiert. Weiterlesen
Carrie Solomon ist Foodfotografin, Adrian Moore schreibt Artikel über kulinarische Trends, beide leben und arbeiten in Paris. Jeder kennt den Ausspruch „die kochen auch nur mit Wasser“. Stimmt das, ist das wirklich so? Solomon und Moore haben sich gemeinsam gefragt mit welchen Zutaten kochen Europas Spitzenköche in ihren privaten Küchen daheim. Und was wäre da hilfreicher als ein Blick in deren Kühlschranke? Also haben sie sich aufgemacht, sind quer durch Europa gereist, haben insgesamt 40 Sterneköche besucht und den Inhalt ihrer privaten Kühlschränke inspiziert und dokumentiert. Weiterlesen
Fender Jazz Bassist
Gerade habe ich mir einen Fender Jazz Bass (AM STD, 3TS) zu einem guten Kurs bei dem letztverbliebenen lokalen Dealer gekauft. Habe ja schon berichtet, dass im Projektstudio immer öfter Mal ein schneller Basstrack anfällt und da will man eben gewappnet und entsprechend ausgerüstet sein („You want to be prepared!“).
Bezüglich Firma und Modell hatte ich dann sozusagen keine wirklich Wahl mehr, wenn man mal so rumschaut wer, wann und wo dieses klassische Instrument einsetzt. Passt meines Erachtens auch gut zu den Musikstilen, mit denen ich so zu tun habe. Bin jetzt ein Fender Jazz Bassist. „Bass! How low can you go?“
Album: So klingt Würzburg 2016! (1)
 Seit Jahren nehme ich in meinem Projektstudio Gesang und akustische Instrumente für Songdemos, Vorproduktionen, Albumproduktionen auf. Ich verwende dafür einen iMac, ein Presonus-Interface und diverse Neumann-Mikrophone. Ab 2013 habe ich dann auch Aufnahmen für Schüler, Studenten und andere Interessierte gemacht. 2015 kam es dann zu einigen Auftragsproduktionen von Einzelsongs, ich habe immer mal wieder auf dem Blog darüber berichtet. Ab Sommer 2015 bis ins neue Jahr liefen nun mehrere, aufwändige Songproduktionen parallel, die mich zum Teil ganz schön eingenommen haben. Ich habe jeweils die Vorproduktion und die Aufnahmen von Gesang, Gitarren und weiteren Instrumenten betreut, einige instrumentale Parts für Gitarre, Backgroundgesang, Xylophon, Klavier und E-Bass habe ich meist auch noch beigesteuert.
Seit Jahren nehme ich in meinem Projektstudio Gesang und akustische Instrumente für Songdemos, Vorproduktionen, Albumproduktionen auf. Ich verwende dafür einen iMac, ein Presonus-Interface und diverse Neumann-Mikrophone. Ab 2013 habe ich dann auch Aufnahmen für Schüler, Studenten und andere Interessierte gemacht. 2015 kam es dann zu einigen Auftragsproduktionen von Einzelsongs, ich habe immer mal wieder auf dem Blog darüber berichtet. Ab Sommer 2015 bis ins neue Jahr liefen nun mehrere, aufwändige Songproduktionen parallel, die mich zum Teil ganz schön eingenommen haben. Ich habe jeweils die Vorproduktion und die Aufnahmen von Gesang, Gitarren und weiteren Instrumenten betreut, einige instrumentale Parts für Gitarre, Backgroundgesang, Xylophon, Klavier und E-Bass habe ich meist auch noch beigesteuert.
Auftraggeber und Hauptakteure waren das transpazifische Duo Zacq & Mari (Zacquine Miken & Marius-Antonin Fleck), der Liedermacher Simon-Philipp Vogel, die Songschreiberin Mandy Stöhr und die Sängerin Sandra Buchner. Sie haben jeweils 2-3 Einzelsongs von mir produzieren lassen, gemischt, gemastert und oft auch Schlagzeug gespielt hat Jan Hees, Kontrabass spielte Camilo Goitia. Weitere, vielversprechende Produktionen sind momentan noch in Arbeit.
Die konzeptionellen Ansätze und musikalischen Ergebnisse der einzelnen Projekte unterscheiden sich selbstverständlich, aber sie haben auch etwas gemeinsam. Sie wurden innerhalb eines Jahres von einer Person in einem Raum aufgenommen und alle Beteiligten (Songschreiber, Musiker, Techniker) stammen aus einer Stadt: Würzburg.
Damit diese gelungenen, fein geschliffenen Songperlen nicht einfach in den sprichwörtlichen Schubladen verschwinden, habe ich vorgeschlagen ein Album mit den Tracks zu veröffentlichen und alle waren auch gleich einverstanden. Geplant ist also ein Album mit 10-12 Tracks, Arbeitstitel: „So klingt Würzburg 2016! – Produced & presented by Dennis Schütze“. Wenn alles gut geht, wird es voraussichtlich Mai/Juni 2016 erscheinen, also pünktlich zum hoffentlich freundlichen Frühsommer. Gerade arbeiten wir noch an den letzten Beiträgen, acht sind bereits gesetzt, steht alles soweit. Flankiert wird das Album von einem klitzekleinen Releasekonzert und diversen Musikvideos der einzelnen Beteiligten (Ankündigung folgt). Wir sind eine kleine, verschwörerische Truppe und unterstützen uns gegenseitig. Coole Sache. Stay tuned!
Über Respekt
Letztens spielten wir mit den Musikstudenten bei einer privaten Feierlichkeit. Erst zum Sektempfang, dann zum mehrgängigen Abendessen und am Ende zum ausgelassenen Tanz. War eine tolle Party. Den halben Abend wurden wir dabei wohlwollend von einem vollbärtigen Mitdreißiger beobachtet. Als wir weit nach Mitternacht Schluss machten, unsere Instrumente einpackten und die Kabel zusammenrollten, kam er auf uns zu. Er hatte bereits ordentlich einen sitzen, war bester Laune und sprach: „Ey, ihr seid ’ne super Band, geile Musik, des muss ich jetzt Mal respektlos anerkennen!“ Dabei schürzte er die Lippen und nickte dazu, dann lächelte er sanft, drehte sich um, ging zur Bar und genehmigte sich noch einen.
Larry Garner @ Beavers, Miltenberg
 Gestern spielte Larry Garner aus Baton Rouge im Beavers, Miltenberg. Traditioneller, amerikanischer Electric Blues, Songs aus eigener Feder und britisches Backing (Norman Beaker Band). In Songwriting, Solos und Texten wimmelte es nur so von altbekannten Klischees, war trotzdem irgendwie gut und stimmig. Garner bedankte sich auf deutsch: „Danke, dass sie den Blues unterstützen!“ Guter Performer, sympathischer Typ.
Gestern spielte Larry Garner aus Baton Rouge im Beavers, Miltenberg. Traditioneller, amerikanischer Electric Blues, Songs aus eigener Feder und britisches Backing (Norman Beaker Band). In Songwriting, Solos und Texten wimmelte es nur so von altbekannten Klischees, war trotzdem irgendwie gut und stimmig. Garner bedankte sich auf deutsch: „Danke, dass sie den Blues unterstützen!“ Guter Performer, sympathischer Typ.
Buch: „Marmor, Stein und Liebeskummer“ von Christian Bruhn
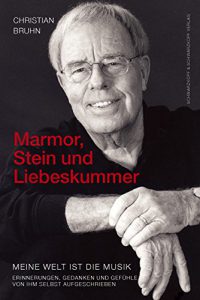 Christian Bruhn ist Komponist und Musikproduzent. In der Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit verfasste er unzählige, zum Teil sehr erfolgreiche Schlager. Später komponierte er Film-, Fernsehmusik und Werbemelodien. Von 1991 bis 2009 war er Aufsichtsratsvorsitzender der GEMA und bis 2007 Präsident der CISAC (Dachorganisation der Urheberrechtsgesellschaften). Mit „Marmor, Stein und Liebeskummer“ legte der Bruhn im Jahr 2005 in Anspielung an einen seiner größten Hits seine Autobiographie vor. Sie trägt den Untertitel „Erinnerungen , Gedanken und Gefühle von ihm selbst aufgeschrieben“. Weiterlesen
Christian Bruhn ist Komponist und Musikproduzent. In der Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit verfasste er unzählige, zum Teil sehr erfolgreiche Schlager. Später komponierte er Film-, Fernsehmusik und Werbemelodien. Von 1991 bis 2009 war er Aufsichtsratsvorsitzender der GEMA und bis 2007 Präsident der CISAC (Dachorganisation der Urheberrechtsgesellschaften). Mit „Marmor, Stein und Liebeskummer“ legte der Bruhn im Jahr 2005 in Anspielung an einen seiner größten Hits seine Autobiographie vor. Sie trägt den Untertitel „Erinnerungen , Gedanken und Gefühle von ihm selbst aufgeschrieben“. Weiterlesen
Über Bildungswege
„When I think back
on all the crap I learned in high school
,
It’s a wonder
I can think at all
,
And though my lack of education
hasn’t hurt me none,
I can read the writing on the wall.“
Paul Simon: „Kodachrome“ (Album: There goes rhymin‘ Simon, 1973)
