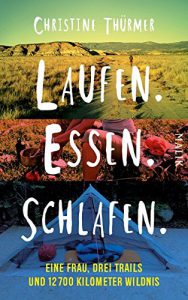 Zum Jahresende 2003 wird Christine Thürmer ihre Stelle als Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens gekündigt, sie nutzt die unvorhergesehene Gelegenheit und bricht auf um sich einen lang gehegten Traum zu erfüllen: Sie will den Pacific Crest Trail (www.pcta.org) von der mexikanischen Grenze im Süden Kaliforniens bis zur kanadischen Grenze im nördlichen Bundesstaat Washington zu Fuß durchwandern und plant dafür fünf Monate von Ende April bis Mitte Oktober ein. Für Thürmer ist diese Wanderung nicht nur Mut- und Bewährungsprobe, sie wird geradezu zur extremen Selbsterfahrung und führt zu einer schicksalhaften Entscheidung. Nach einer kurzen Rückkehr in den bürgerlichen Beruf, durchwandert sie 2007 den Continental Divide Trail (www.contonentaldividetrail.org) von Nord nach Süd über die Rocky Mountains und danach 2008 – als vorläufigen Abschluss ihrer USA-Durchwanderung – den Appalachian Trail (appalachiantrail.org) von Nord nach Süd über die Appalachen. Sie erringt somit nach insgesamt 12.700km Langstreckenwanderung aufgeteilt in drei Routen quer durch die USA die sog. triple crown, eine besondere Auszeichnung der American Long Distance Hiking Association (ALDHA). In ihrem Buch „Laufen.Essen.Schlafen.“ beschreibt sie die Wanderungen vom beschwerlichen Anfang bis zum beeindruckenden Ende. Weiterlesen
Zum Jahresende 2003 wird Christine Thürmer ihre Stelle als Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens gekündigt, sie nutzt die unvorhergesehene Gelegenheit und bricht auf um sich einen lang gehegten Traum zu erfüllen: Sie will den Pacific Crest Trail (www.pcta.org) von der mexikanischen Grenze im Süden Kaliforniens bis zur kanadischen Grenze im nördlichen Bundesstaat Washington zu Fuß durchwandern und plant dafür fünf Monate von Ende April bis Mitte Oktober ein. Für Thürmer ist diese Wanderung nicht nur Mut- und Bewährungsprobe, sie wird geradezu zur extremen Selbsterfahrung und führt zu einer schicksalhaften Entscheidung. Nach einer kurzen Rückkehr in den bürgerlichen Beruf, durchwandert sie 2007 den Continental Divide Trail (www.contonentaldividetrail.org) von Nord nach Süd über die Rocky Mountains und danach 2008 – als vorläufigen Abschluss ihrer USA-Durchwanderung – den Appalachian Trail (appalachiantrail.org) von Nord nach Süd über die Appalachen. Sie erringt somit nach insgesamt 12.700km Langstreckenwanderung aufgeteilt in drei Routen quer durch die USA die sog. triple crown, eine besondere Auszeichnung der American Long Distance Hiking Association (ALDHA). In ihrem Buch „Laufen.Essen.Schlafen.“ beschreibt sie die Wanderungen vom beschwerlichen Anfang bis zum beeindruckenden Ende. Weiterlesen
Foto: A closer look from far away
RIP: Roger Cicero
Im Sommer 2007 spielte ich mit der Dennis Schütze Band bei der BR-Radltour in Neustadt an der Aisch. Es gab eine große Centerstage für den Topact des Abends und ein kleine Bühne abseits für uns. Man hatte uns gebeten bereits am frühen Nachmittag da zu sein, obwohl unser kurzer Auftritt erst am Abend stattfinden sollte. Als wir ankamen zogen dunkle Wolken auf und man teilte uns mit, dass wir schon mal unser Equipment auspacken sollten. Als wir das getan und unsere Autos weit weg geparkt hatten, brach ein heftiges Gewitter los, es war kein Mensch mehr weit und breit auf dem großen Gelände zu sehen und wir schafften es gerade noch unser Zeug in den Laderaum eines offenen LKWs zu packen. Dort standen wir dann lange und schauten dem Unwetter zu wie es wütete. Wir waren klatschnass, ziemlich angenervt und mussten auch nach Ende des Gusses noch Stunden warten bis wir endlich aufbauen durften. Als alles auf der Bühne stand und verkabelt war, hieß es sorry, aber der Soundcheck muss wegen der zeitlichen Verzögerung leider ausfallen, jetzt ist der Topact dran, ihr spielt nachher ohne Check, wird während den ersten Liedern geregelt. Ich kann gar nicht sagen, wie wütend ich war, ich stand kurz davor mein Zeug zusammen zu packen und nach hause zu fahren. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon locker 4h an der Bühne gestanden und gewartet. Ich ging also ab von unserer Minibühne und wartete schlecht gelaunt auf den Soundcheck des Topact des Abends. Dann geschah etwas Wunderbares. Weiterlesen
Musikproduktion: „Seelentreter“ von Mandy Stöhr
In den letzten Monaten habe ich für die Würzburger Sänger/Songschreiberin Mandy Stöhr zwei Einzeltracks produziert. Sie hatte den Song selbst geschrieben, wir haben daran gemeinsam noch etwas geschraubt und gefeilt, danach wurde arrangiert und aufgenommen und bis Ende Dezember war dann alles soweit im Kasten. Inzwischen wurde bereits ein weiterer Song geschrieben, aufgenommen, gemischt und gemastert.
Mandy Stöhr hat gerade den ersten Track auf Soundcloud gestellt und auf Facebook präsentiert. Es handelt sich dabei um die deutschsprachige Eigenkomposition „Seelentreter“. Sie selbst hat akustische Gitarre, Lead- und Chorstimmen beigesteuert, E-Gitarre und Orgel stammen von mir, Kontrabass spielte Camilo Goitia ein, Schlagzeug und Percussion kommt von Jan Hees und der hat auch Mix und Master besorgt. Produziert wurde der Track von Mandy Stöhr & Dennis Schütze. Dieser und ein weiterer Track werden auf dem Album „So klingt Würzburg 2016!“ enthalten sein, das im Mai erscheinen wird.
Jetzt freuen wir uns auf interessierte Hörer. Kommentare und Feedback sind wie immer willkommen.
My Favourite Jazz Albums
Jazzmusik habe ich als Kind erstmals durch die Schallplattensammlung meines Vaters kennengelernt, das war allerdings eher traditioneller Jazz von Musikern und Gruppen wie z.B. Sidney Bechet, Louis Armstrong, Firehouse Five plus Two oder Ramsey Lewis. In meiner Jugend lag dann eigentlich nichts ferner als Jazz zu hören, obwohl Musik selbst sehr wohl eine große und immer größere Rolle gespielt hat. Auch in der Schule, Musikschule, Berufsfachschule wurde hier kein entscheidender oder nachhaltiger Beitrag geleistet. Erst im Musikstudium am Würzburger Konservatorium gab es Mitstudenten, die nicht Klassik (wie ich), sondern eben Jazz studierten, sie waren interessiert am technisch-instrumentalen Fortkommen, aber ganz ehrlich, die meisten von denen hörten selbst allenfalls mal jazzverwandtes, aber nicht gerade Jazz. Das fiel mir besonders auf, als ich freiwillig (als „Klassiker“) die Kurse Jazzharmonielehre und Jazzgeschichte besuchte. Weiterlesen
Buch: „Arrival of the Fittest“ von Andreas Wagner
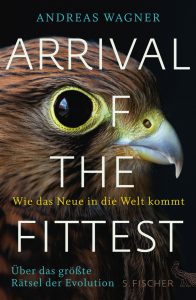 Der US-Amerikaner Andreas Wagner ist Professor für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften der Universität Zürich. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Fachpublikationen ist „Arrival of the Fittest“ Wagners erste populärwissenschaftliche Veröffentlichung. Das Buch erschien 2014 im gleichnamigen, englischen Original. Die deutsche Version trägt den Untertitel „Wie das Neue in die Welt kommt – Über das größte Rätsel der Evolution“. Wagner beginnt mit einem Prolog, darauf folgen sieben Kapitel und ein sehr kurzer Epilog. Die Kapitelüberschriften lauten: 1. Was Darwin noch nicht wusste, 2. Der Ursprung der Neuerungen, 3. Die universelle Bibliothek, 4. Wohlgeformte Schönheiten, 5. Befehl und Steuerung, 6. Die verborgene Architektur, 7. Von der Natur zur Technik, weitere Unterteilungen, Unterüberschriften oder Stichwörter gibt es in mehr 400-seitigen Schrift leider nicht, ebenso kein Glossar und nur wenige, noch dazu sehr abstrakte bildliche Darstellungen, die inhaltliche Orientierung fällt daher etwas schwer. Weiterlesen
Der US-Amerikaner Andreas Wagner ist Professor für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften der Universität Zürich. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Fachpublikationen ist „Arrival of the Fittest“ Wagners erste populärwissenschaftliche Veröffentlichung. Das Buch erschien 2014 im gleichnamigen, englischen Original. Die deutsche Version trägt den Untertitel „Wie das Neue in die Welt kommt – Über das größte Rätsel der Evolution“. Wagner beginnt mit einem Prolog, darauf folgen sieben Kapitel und ein sehr kurzer Epilog. Die Kapitelüberschriften lauten: 1. Was Darwin noch nicht wusste, 2. Der Ursprung der Neuerungen, 3. Die universelle Bibliothek, 4. Wohlgeformte Schönheiten, 5. Befehl und Steuerung, 6. Die verborgene Architektur, 7. Von der Natur zur Technik, weitere Unterteilungen, Unterüberschriften oder Stichwörter gibt es in mehr 400-seitigen Schrift leider nicht, ebenso kein Glossar und nur wenige, noch dazu sehr abstrakte bildliche Darstellungen, die inhaltliche Orientierung fällt daher etwas schwer. Weiterlesen
Film: „Miles Ahead“
Trailer zur Filmbiographie „Miles Ahead“ über den legendären Jazztrompeter und Musikinnovator Miles Davis, ein Projekt von Don Cheadle (Drehbuch, Regie, Hauptrolle). Frei nach Miles: „One bad Motherfucker!“ Startet am 1. April in den amerikanischen Kinos, ob und wenn wann der Film auch in Deutschland gezeigt wird, war nicht in Erfahrung zu bringen.
Songproduktion: „Am Ende aller Tage“ von Simon-Philipp Vogel
Es kommt gerade Schlag auf Schlag: Nach neun Monaten Funkstille hat der Würzburger Liedermacher Simon-Philipp Vogel heute eine neue Songproduktion mit dem Titel „Am Ende aller Tage“ veröffentlicht. Ein frisches, unkitischiges Liebeslied in zeitgemäßen Sound und mit entspanntem Groove.
Ich habe mitproduziert, beim Arrangement assistiert und Klavier und E-Bass beigesteuert. Schlagzeug, Mix und Master stammen von Jan Hees. Und jetzt drückt auf Play und lasst euch auf Händen tragen. Kommentare und Feedback aller Art sind wie immer herzlich Willkommen.
Album: „Erinnerung“ von Marie Schwind
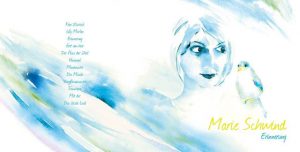 Marie Schwind habe ich in einem Songwriting-Kurs an der Würzburger Universität kennengelernt. Sie war damals Studentin, ich habe den Kurs als Lehrbeauftragter einige Semester geleitet, kurz danach wurde der Kurs bedauerlicherweise ohne weitere Erklärung wegrationalisiert. Marie war als gute Sängerin zum Kurs gestoßen, ich glaube, sie spielte auch schon Klavier und fing dann mit Gitarre an, wie auch immer, jedenfalls hat sie sich voll auf die Inhalte eingelassen, viel ausprobiert und geschrieben, in einem atemberaubendem Tempo dazugelernt und nahezu wöchentlich neue Ideen präsentiert. Als der Kurs zu Ende ging hatte sie bereits mehrere Songs fertig geschrieben und, meiner Erinnerung nach, sehr viele Texte geschrieben. Weiterlesen
Marie Schwind habe ich in einem Songwriting-Kurs an der Würzburger Universität kennengelernt. Sie war damals Studentin, ich habe den Kurs als Lehrbeauftragter einige Semester geleitet, kurz danach wurde der Kurs bedauerlicherweise ohne weitere Erklärung wegrationalisiert. Marie war als gute Sängerin zum Kurs gestoßen, ich glaube, sie spielte auch schon Klavier und fing dann mit Gitarre an, wie auch immer, jedenfalls hat sie sich voll auf die Inhalte eingelassen, viel ausprobiert und geschrieben, in einem atemberaubendem Tempo dazugelernt und nahezu wöchentlich neue Ideen präsentiert. Als der Kurs zu Ende ging hatte sie bereits mehrere Songs fertig geschrieben und, meiner Erinnerung nach, sehr viele Texte geschrieben. Weiterlesen
Buch: „Panikherz“ von Benjamin von Stuckrad-Barre
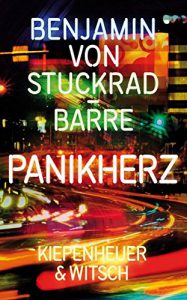 Benjamin von Stuckrad-Barre ist Schriftsteller, Journalist und Moderator. Seit seinem Debutwerk „Soloalbum“ (1998) gilt er als bedeutender, deutscher Popliterat. Nach verschiedenen Praktika folgten Anstellungen als Redakteur beim deutschen Rolling Stone, als Produktmanager beim Plattenlabel Motor Music und als Autor der Harald Schmidt Show. Nebenbei war er als freier Mitarbeiter diverser Zeitungen und Magazine wie FAZ, Die Woche, Stern und taz tätig. Nach turbulenten Anfangsjahren und verschiedenen Buch- und Artikelveröffentlichungen hat er sich seit 2010 wechselnden TV-Formaten gewidmet. Stuckrad-Barre moderierte u.a. „Stuckrad Late Night“ (ZDFneo), „Stuckrad-Barre“ (Tele 5) und „Stuckrads Homestory“ (RBB), allesamt mit eher mäßigem Erfolg. Mit dem autobiographisch geprägtem „Panikherz“ schließt er wieder an seine früheren literarischen Erfolge an und legt eine gewichtige und nüchterne (!) Selbstbetrachtung vor. Weiterlesen
Benjamin von Stuckrad-Barre ist Schriftsteller, Journalist und Moderator. Seit seinem Debutwerk „Soloalbum“ (1998) gilt er als bedeutender, deutscher Popliterat. Nach verschiedenen Praktika folgten Anstellungen als Redakteur beim deutschen Rolling Stone, als Produktmanager beim Plattenlabel Motor Music und als Autor der Harald Schmidt Show. Nebenbei war er als freier Mitarbeiter diverser Zeitungen und Magazine wie FAZ, Die Woche, Stern und taz tätig. Nach turbulenten Anfangsjahren und verschiedenen Buch- und Artikelveröffentlichungen hat er sich seit 2010 wechselnden TV-Formaten gewidmet. Stuckrad-Barre moderierte u.a. „Stuckrad Late Night“ (ZDFneo), „Stuckrad-Barre“ (Tele 5) und „Stuckrads Homestory“ (RBB), allesamt mit eher mäßigem Erfolg. Mit dem autobiographisch geprägtem „Panikherz“ schließt er wieder an seine früheren literarischen Erfolge an und legt eine gewichtige und nüchterne (!) Selbstbetrachtung vor. Weiterlesen

