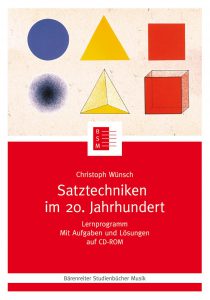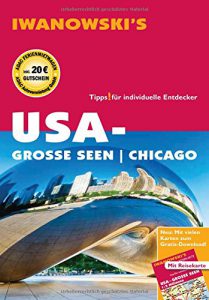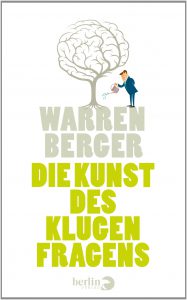Meine Studienzeit liegt schon eine Weile zurück. Als ich das (Zweit-) Studium der Musikwissenschaft an der bayerischen Universität meiner Heimatstadt antrat, hatte ich gerade das Diplom an einer Hochschule für Musik absolviert. Es war ein praktisch orientiertes Studium gewesen, abgesehen vom Hauptfach, wo man den Lehrer zweimal die Woche in einer Eins-zu-eins Situation gegenüber saß, hatte es kaum Gelegenheiten für einen erweiterten fachlichen Austausch gegeben. Musikpädagogische Erfahrungen sammelte man alleine, es wurde kaum was empfohlen, besprochen oder diskutiert. Aus diesem Grund hatte ich mich auch für ein anschließendes, geisteswissenschaftliches Studienfach entschieden. Für mich gab es mit dem Beginn des Zweitstudiums einiges nachzuholen. Insbesondere in meinen Nebenfächern Amerikanistik und Kulturwissenschaft englischsprachiger Länder gab es bergeweise Texte aus mehr als 500 Jahren zu lesen. Ich richtete mich dabei nach einer Liste von Titeln die im ersten Semester an alle Studenten als kleines, kopiertes Heftchen ausgegeben worden war. Ob man diese Titel gelesen hatte, interessierte im weiteren Verlauf aber dann niemanden mehr. Im Grundstudium wurden in den Einführungskursen und Proseminaren verschiedene Themen an die Kursteilnehmer verteilt, man musste ein Referat darüber halten und am Ende des Semesters eine Seminararbeit abgeben. Lehrbeauftragte waren gestresst und hatten kaum Zeit, Professoren waren so gut wie nicht ansprechbar. So ging es im Hauptstudium weiter: Vorlesung und Seminar besuchen, Referate der Mitstudierenden anhören, Seminararbeit schreiben und abgeben, Schein abholen. Meinungsaustausch oder Diskussionen gab es nicht.
Im Fach Musikwissenschaft wurde mir aufgrund meines Diploms das Grundstudium erlassen. Im Hauptstudium lief es dann allerdings ähnlich ab wie in meinem Nebenfächern: Vorlesungen besuchen und 90 Min. zuhören wie ein Professor schwer verständlich aus seinem Manuskript abliest. Hauptseminare besuchen, Referate der Mitstudierenden anhören, Seminararbeit schreiben, abgeben, Schein abholen, fertig.
Weil ich bereits mein Zweitstudium belegte, war ich schon etwas älter als die meisten meiner Kommilitonen, ich arbeitete damals schon seit mehreren Jahren als Instrumentallehrer und freier Musiker. Das Studium belegte ich nicht in erster Linie um einen Abschluss zu erlangen, sondern aus prinzipiellem Interesse am Fach. Ich hatte damals auch genügend Zeit und mir war oft langweilig. Ich reagierte deswegen oft ungehalten, wenn ich den Weg zur Uni auf mich genommen hatte, vielleicht sogar früh aufgestanden war, und dann von Mitstudenten, Lehrbeauftragten oder Professoren mitunter unengagierte, bräsige Vorträgen anhören musste.
Ich muss für die Seminarteilnehmer und Professoren ein unangenehmer und lästiger Student gewesen sein. Am Ende solcher Vorträge begann ich aus Langeweile und zum Spaß Fragen zu stellen, Ideen zu äußern, unfertige Theorien zu entwickeln, ich wollte mich unterhalten, diskutieren, mit offenen Ausgang streiten. Immer wieder hatte ich gehört, dass der Sinn eines Studiums sei zu einer eigenständigen, kritischen Persönlichkeit heranzureifen. Aber Diskussionen waren nicht erwünscht, sie wurden nicht befördert und sportlich mit Argumenten ausgetragen, nein, ihnen wurde kein Raum gegeben, sie wurden abgewürgt, unkonventionelle Fragen oder provokante Ideen waren nicht erwünscht, es gab keine offenen Foren für (musik-)wissenschaftlichen Austausch, keine inoffiziellen Begegnungsstätten. Stattdessen wurden etablierte, akademische Hierarchien gepflegt, auf Titel und Werdegang wurde genau geachtet. Professoren waren „untouchable“, angeblich immer im Stress, für normale Studierende kaum erreichbar. Ihnen wurde zugearbeitet von Privatdozenten, Doktoranten, Sekretärinnen, HiWis und Tutoren, ein opportunistisches System in dem keiner etwas riskieren wollte/konnte, denn die Stellen sind schwer umkämpft. Kein Platz also für offenen, (musik-)wissenschaftlichen Diskurs.
Von Seiten einiger weniger Lehrbeauftragten und Mitstudenten hatte es ein paar Lichtblicke gegeben, im Großen und Ganzen war ich von den Strukturen jedoch maßlos enttäuscht, von meinen Fächern aber nach wie vor begeistert. Nach dem Ende meines Magisterstudiums brauchte ich deswegen etwas Abstand und stellte für mich fest, dass die konservativen, festgefahrenen Strukturen vielleicht eine Besonderheit meiner Alma Mater gewesen sein könnten. Mittlerweile war mir klarer, wohin sich mein fachliches Interesse ausrichtete, ich begann entsprechende Fachliteratur zu sammeln, mich einzulesen, vereinbarte Termine, führte Gespräche und fand schließlich einen Doktorvater, der bereit war mein Promotionsprojekt zu betreuen.
Während der Promotionszeit war ich Externer, das heißt, ich hatte während der Zeit keinen Job oder Lehrauftrag an der Hochschule. Das ist ungewöhnlich, meist sind eine befristet Anstellung und die Möglichkeit zur Promotion in Deutschland eng miteinander verknüpft. Zumeist ergeben sich daraus ungesunde Abhängigkeiten zwischen Doktorand und Betreuer. Bei mir stand das nicht zur Debatte, weil eine entsprechende Stelle nicht existierte und für mich auch nicht von besonderem Interesse gewesen wäre. Ich verdiente mein Geld zu dem Zeitpunkt auf sehr angenehme Weise als Instrumentalpädagoge und freier Musiker. Mein spezieller Status brachte aber auch organisatorische Nachteile mit sich. Andere Promotionsstudenten, die Mo-Fr im Vor- oder Nebenzimmer ihres Profs verbrachten, waren dauerhaft und topaktuell über neuste Entwicklungen informiert, weil der Informationsfluss der Fakultät mehr oder weniger über ihren Schreibtisch ging bzw. sie beim gemeinsamen Kaffee oder Mittagsessen davon Wind bekamen. Im Gegenzug wurden sie allerdings ständig durch auferlegte Handlangertätigkeiten von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten. Meist hatten (und haben) sie halbe Stellen, verrichten aber die Arbeit ganzer Stellen, ihre wissenschaftlichen Arbeiten kommen nicht vom Fleck, sie müssen an Abenden, Wochenenden und im Urlaub schreiben. Oft ziehen sich ihre Doktorarbeiten über viele Jahre in die Länge, manche werden damit nie fertig.
Ich konnte mir dagegen meine Zeit frei einteilen, bekam aber viele Dinge zu spät oder gar nicht mit. Ich versuchte meinen Betreuer wenigstens 1-2 im laufenden Semester zu sehen, eine Arbeitsprobe zuzumailen und bei einem gemeinsamen Mittagessen zu besprechen. Obwohl ich Doktorand war, war es für mich aber fast immer schwer einen Termin zu bekommen. Oft lagen zwischen dem Versenden der Arbeitsprobe und einer konkreten inhaltlichen Fragestellung 2-3 Wochen. In der Zeit hatte ich längst eine eigene Antwort gefunden, eine Lösung improvisiert und weitergeschrieben, bei den Treffs hatte ich längst neue Themen zu besprechen, aber eine neuere Arbeitsprobe hatte der Betreuer nicht mehr bekommen, nicht ausgedruckt, nicht gelesen.
Noch mehr als im Grund- und Hauptstudium fehlte mir ein verlässlicher Ansprechpartner, ein erfahrenes Gegenüber, ich verlor unheimlich viel Zeit, weil ich Umwege machte, im Nebel rumstocherte, an Lappalien kleben blieb, vermeidbare Fehler machte. Ich fuhr deswegen zu Tagungen und Kongressen, hielt Vorträge, hörte mir andere Vorträge an. Die Hierarchien zwischen etablierten Professoren, Privatdozenten, Doktoranten und einfachen Studenten war dort dieselbe wie an Uni und Hochschule meiner Heimatstadt. Professoren blieben unter sich, vollkommene Ellbogenmentalität, Buckeln nach oben, Treten nach unten. Es gab hier punktuellen wissenschaftlichen Austausch, aber die Themen waren extrem speziell, die Zeit extrem knapp (15-20 Min. Vortrag, 5-10 Min Diskussion). Die wohl wichtigste Erfahrung war, dass sich andere zum Teil in viel prekäreren Situationen befanden als ich (Geldnot, Zeitnot, schlechte Stimmung, Isolation, etc.).
Im Nachschlag werden einige ausgewählte Vorträge solcher Tagungen verschriftlicht und in einem Jahrbuch oder Tagungsband zusammengefasst. Der erscheint dann meist 12-18 Monate später als Buch, ist also alles andere als eine unmittelbare Äußerung, sondern eine komplett ausgearbeitete und abgesicherte These. Es kommt dazu, dass das Schreiben eines Artikels nicht finanziell honoriert wird, das heißt, ein Autor schreibt je nach Aufwand ca. 2-6 Wochen ohne jede Bezahlung an solch einem Text. Das können sich festangestellte Professoren leisten, Doktoranden und einfache Studenten eher nicht, die schreiben ja bereits an ihren Promotionsschriften, Master- und Bachelorarbeiten ohne was dafür zu bekommen.
Ich kann mich erinnern, dass mein Betreuer kurz vor der Abgabe meiner Promotionsschrift ein paar Kollegen aus dem Flur zusammentrommelte um für mich als Zuhörer zur Verfügung zu stehen. Ich referierte eine ca. 30 Min Zusammenfassung meines Themas an dem ich bis dahin ca. 6 Jahre recherchiert und über 400 Seiten geschrieben hatte. Es kamen schließlich drei von vielen Eingeladenen, einer kam später, eine andere musste früher gehen, mein Betreuer war die ganze Zeit da, mit meinem popmusikalischen Thema war keiner im Ansatz vertraut. Vielmehr inhaltlichen Austausch gab es kaum, mit dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses ging es meist um Termine und Formalitäten (Ist eine Veröffentlichung als ebook erlaubt oder eine kostenintensive Printversion erforderlich?). Ähnlich lief es auch während der Prüfung. Alle beteiligten Prüfer hatten sichtlich Angst sich mit einer verfänglichen Frage vor den Kollegen und dem Protokollführer zu blamieren. Ich war inhaltlich auf eine Verteidigung meiner These eingestellt, ein Diskurs oder eine Diskussion, die diesen Namen verdient, entstand an diesem Tag leider nicht. Ich bin von keinem der Beteiligten jemals wieder auf mein Promotionsthema angesprochen worden.
Nach diesen diversen Erfahrungen stelle ich mir heute als promovierter Musikwissenschaftler die Frage: Wo findet eigentlich musikwissenschaftlicher Diskurs statt?
Meine ernüchternde Erfahrung hat mir gezeigt, dass ein Diskurs nicht in den Vorlesungen und Seminaren von Hochschulen und Universitäten stattfindet, jeder arbeitet für sich, es gibt kaum Austausch, kein Interesse aneinander, keine Fragestunde, Sprechstunden sind knapp bemessen, seit Bologna zählen noch mehr als bereits vorher Noten, Punkte, Scheine, Diskussionen gelten als Zeitverschwendung. Unmittelbar findet ein Diskurs meiner Erfahrung nach auch nicht bei Kongressen und Tagungen statt, dazu sind derlei Veranstaltungen schon strukturell viel zu exklusiv (Anreisekosten, Übernachtungskosten, Eintrittsgeld (selbst für Referenten), kaum zirkulierte Ankündigungen, extrem langfristige Planung. Die Professoren bleiben unter sich, für aufstrebende, etablierte Kräfte ist es ein Präsentationsforum, eine Jobmesse, ein Who-is-Who, es geht dabei nicht in erster Linie um Inhalte oder Argumente.
Auffällig ist auch, dass es nahezu keine Kritik musikwissenschaftlicher Literatur gibt. In den Feuilletons von etablierten Zeitungen und Zeitschriften werden solche Inhalte nicht besprochen. In den allermeisten Fällen haben die Autoren keine eigenen Webseiten (stattdessen standardisierte und oft deutlich veraltete Bios auf dem eigenen Uni-Server), von einem Blog mit Kommentarfunktion ganz zu schweigen. Selbst Fachkollegen haben keine Zeit oder kein Interesse derartige Texte zu lesen, allenfalls ein sog. Abstract, eine ca. halbseitige Zusammenfassung. Bestenfalls können die Autoren einen Kollegen überreden wenigstens einen ankündigungsartigen Text zu verfassen. Auf eine Buchveröffentlichung substanziell zu reagieren, eine alternative Sichtweise aufzeigen? Warum sich die Arbeit machen, warum sich Kollegen zu Gegnern machen, warum Gräben aufreißen? Es gibt umfangreiche, aufwändige Sammelbände die Monate und Jahre nach Erscheinen keine einzige Kundenrezension beim führenden Versandbuchhändler Amazon vorweisen können. Startet man eine Google-Suche findet man außer den Verlagsseiten keine weitere Erwähnung. Die Leute arbeiten einsam und isoliert vor sich hin, reagieren nicht auf die Thesen anderen und ärgern sich vermutlich selbst darüber keine Reaktionen hervorgerufen zu haben.
Ich habe bald festgestellt, dass die Veröffentlichung wissenschaftlicher Aufsätze in Printformat nicht meine Sache sind. Es dauert lange bis eine These entwickelt und eine solcher Arbeit wasserdicht formuliert ist, man kann sie dann einreichen, eventuell wird sie abgelehnt, vielleicht nach weiteren Veränderungen angenommen, dann erscheint der Text 12-24 Monate später in Kleinstauflage in einem Sammelband für 30-60 Euro, es gibt keine Werbung, keine Besprechungen, keine Reaktionen. Durchblättern werden das Buch wohl nur die Autoren, die einen Beitrag geleistet haben, um sicher zu gehen, dass sie auch wirklich drin sind, an den Text werden sie sich im Detail kaum noch erinnern können, es ist zu lange her. Als Außenstehender könnte man sich fragen, warum tun sich die Autoren so was dann überhaupt an? Tja, die Antwort ist, sie haben keine andere Wahl, wenn sie eine wissenschaftliche Stelle im deutschen Bildungssystem haben wollen. In der deutschen Geisteswissenschaft ist die Anzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen die harte Währung in der gezahlt wird, nach der Professuren vergeben werden. Und da kommt es nicht einmal in zweiter Linie auf den Inhalt an und schon gar nicht auf den erfolgten oder folgenden Diskurs an (die Texte liest wie gesagt sowieso kaum einer). Die Anzahl und Orte der Veröffentlichungen werden wie Trophäen gesammelt, es zählt der sogenannte Hirschindex oder Hirschfaktor.
Als Diskursmedium bietet sich das Web 2.0 idealerweise an. Es ist nahezu kostenlos, fast jeder hat freien Zugang, es ist rund um die Uhr geöffnet, arbeitet in Echtzeit, Zitate, Tondokumente, Videos etc. können problemlos verlinkt werden. Außerdem blendet es Hierarchien nahezu aus und durch die schriftliche Form werden Argumente versachlicht. Selbst für sehr spezielle Themen können sich Interessierte zusammenfinden und nicht nur Thesen und Argumente, sondern auch Erfahrungen und Tipps austauschen.
Ich betreibe den „Dennis Schütze Blog“ seit Anfang 2013 und schreibe über Musik, Videos, Filme, Bücher, Notenausgaben, Konzerte, Reisen und Geschichten, die im weitesten Sinne mit Popmusik und Popkultur zu tun haben. Ich kann schreiben was ich will und es sofort veröffentlichen. Es sind Kritiken, Erlebnisberichte, Ankündigungen, Kurzgeschichten, Fotoserien, Meinungen und Kommentare dabei. Auf einige meiner Artikel bekomme ich von Lesern ausführliche und zum Teil sehr fundierte Reaktionen. Seit ich meinen Blog schreibe, lese und kommentiere ich auch Artikel anderer Blogs und profitiere stark davon. Ich habe den Eindruck, dass ich mich endlich in einem fruchtbaren und anregenden, intellektuellen Austausch befinde. Können das Web 2.0 und Blogs die Zukunft des musikwissenschaftlichen Diskurs sein? Ich meine, es ist momentan die viel versprechendste Form der themenspezifischen, weltweit-öffentlichen Kommunikation.
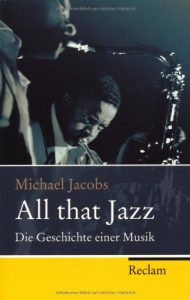 „All that Jazz. Die Geschichte einer Musik“ erschien erstmals 1996 bei Reclam. 2007 erschien eine 3., erweiterte und aktualisierte Ausgabe mit einem zusätzlichen Schlusskapitel von Robert Fischer. Neben „Das Jazzbuch“ (1953) von Joachim-Ernst Berendt und „Sozialgeschichte des Jazz“ (1991) von Ekkehard Jost gehört „All that Jazz“ zu den herausragenden, weil eigenständigen, jazzhistorischen Publikationen in deutscher Sprache und ist allemal eine Retrospektive wert. Über den Autor ist wenig bekannt. Er lebt als freier Publizist, Herausgeber und Übersetzer bei München, weitere Publikationen sind – zumindest im Internet – nicht auffindbar. Der Text ist in 15 Kapitel untergliedert, startet ohne Vorwort oder Einleitung und schreitet chronologisch voran. Es beginnt mit den Wurzeln des Jazz, es folgen New-Orleans-Jazz, Chicago, weiße Musiker der 20er Jahre, schwarzer Big-Band-Jazz, Count Basie, Benny Goodman, Amerikanische Jazzmusiker in Europa, Jazz während WWII, New Orleans Revival & Bebop, Cool Jazz, Hard Bop, Free Jazz & Fusion, Avantgarde & Traditionalisten. Das Buch schließt in der aktuellen Auflage mit dem Kapitel „Aufbruch ins 21. Jahrhundert“ von Robert Fischer (wurde 2007 hinzugefügt).
„All that Jazz. Die Geschichte einer Musik“ erschien erstmals 1996 bei Reclam. 2007 erschien eine 3., erweiterte und aktualisierte Ausgabe mit einem zusätzlichen Schlusskapitel von Robert Fischer. Neben „Das Jazzbuch“ (1953) von Joachim-Ernst Berendt und „Sozialgeschichte des Jazz“ (1991) von Ekkehard Jost gehört „All that Jazz“ zu den herausragenden, weil eigenständigen, jazzhistorischen Publikationen in deutscher Sprache und ist allemal eine Retrospektive wert. Über den Autor ist wenig bekannt. Er lebt als freier Publizist, Herausgeber und Übersetzer bei München, weitere Publikationen sind – zumindest im Internet – nicht auffindbar. Der Text ist in 15 Kapitel untergliedert, startet ohne Vorwort oder Einleitung und schreitet chronologisch voran. Es beginnt mit den Wurzeln des Jazz, es folgen New-Orleans-Jazz, Chicago, weiße Musiker der 20er Jahre, schwarzer Big-Band-Jazz, Count Basie, Benny Goodman, Amerikanische Jazzmusiker in Europa, Jazz während WWII, New Orleans Revival & Bebop, Cool Jazz, Hard Bop, Free Jazz & Fusion, Avantgarde & Traditionalisten. Das Buch schließt in der aktuellen Auflage mit dem Kapitel „Aufbruch ins 21. Jahrhundert“ von Robert Fischer (wurde 2007 hinzugefügt).